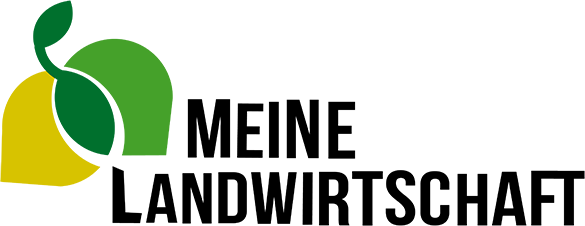Wir brauchen Vielfalt, um unsere Ernährung zu sichern
Immer noch verschwinden in Deutschland täglich über 50 Hektar unbebaute Flächen. Siedlungsbauten und Verkehrsflächen versiegeln unwiderruflich Böden, Straßen zerschneiden Lebensräume. Mit großer Geschwindigkeit fallen naturnahe offene Bodenflächen weg, die Voraussetzung von biologischer Vielfalt sind. Die moderne Landwirtschaft hat zudem immer größere Flächen geschaffen, auf denen wenige Hochleistungssorten angebaut werden und Vielfalt konsequent vernichtet wird: Auf 72 Prozent der deutschen Äcker werden nur noch fünf Kultursorten angebaut. Ackerränder und Brachen für wildes Wachstum gibt es immer seltener. Ein Kommentar anlässlich des Internationalen Tags der biologischen Vielfalt am 22. Mai.
Mit dem Verlust an vielfältigen Lebensräumen geht das Artensterben rasant voran. Dabei führt uns der Klimawandel mit aller Deutlichkeit vor Augen, dass wir zur Sicherung unserer Ernährung große Genpools brauchen, um für veränderte klimatische Bedingungen die passenden Nutzpflanzen parat zu haben. Nur so können wir uns langfristig vor einem Mangel an Nahrungsmitteln schützen.
Die mit der industrialisierten Landwirtschaft verknüpfte Pflanzenzüchtung setzt auf Genbanken, die als große Werkzeugkästen für Neuzüchtungen gesehen werden. Durch Einkreuzungen alter Sorten mit passenden Eigenschaften in moderne Sorten will man Abhilfe schaffen, braucht aber einige Jahre bis zum Erfolg. Durch neue Gentechnik-Verfahren wie CRISPR/Cas 9 soll das beschleunigt werden – gelungen ist dies aber bisher nur für die Züchtung pestizidresistenter Sorten. Die Strategie ist immer die Gleiche: Statt den Blick auf ökologische Kreisläufe zu richten, werden extrem aufwändige technische Lösungen zur Bezwingung der Natur gesucht.
Die ökologische Landwirtschaft dagegen setzt auf an Boden und Klima angepasste Sorten. Ihre Art der Bewirtschaftung lässt das Wachsen von Wildkräutern zu, Vielfalt gibt es auf den bewirtschafteten Flächen sowohl im Bereich der Nutzpflanzen als auch bei den Wildpflanzen. Ein schönes Beispiel ist der Anbau des kürzlich in die Arche des Geschmacks aufgenommenen Westerwälder Fuchsweizens. Die hochwachsende Sorte lässt mehr Licht auf den Boden, Ackerwildkräuter haben so eine Chance, wenn auf Pestizideinsatz verzichtet wird.
Die am 22. März diesen Jahres unter dem Titel »Biologische Vielfalt stärken« vorgestellte neue Biodiversitätsstrategie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft entspricht in Analyse und Zielsetzung der Haltung von Slow Food Deutschland. Mit »Vielfaltsprodukten« werden dort die Tiere und Pflanzen bezeichnet, die Slow Food in der Arche des Geschmacks sammelt. Hier verspricht das Ministerium Maßnahmen zur Förderung von Vernetzung, Information und von innovativen Projekten. Man darf gespannt sein, wie das konkret gefüllt wird. Erforderlich sind auf jeden Fall nicht nur Broschüren und Veranstaltungen. Eine langfristige Regelförderung für engagierte landwirtschaftliche Betriebe und gute Rahmenbedingungen für die Weiterverarbeitung in Mühlen, Bäckereien und Fleischereien sind unbedingt notwendig. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir muss klare Kante zeigen, wenn es um die Durchsetzung geht.
Neben pessimistisch stimmenden Trends gibt es auch gute Nachrichten: Zum einen machen sich stark zurück gedrängte Wildpflanzen mit rasender Geschwindigkeit wieder breit, wenn ihnen passende Lebensräume geboten werden. Zum anderen können wir durch unser Einkaufsverhalten zum Umsteuern beitragen: konsequent Lebensmittel aus der Produktion von Höfen kaufen, die entsprechend den Regeln der Bioverbände wirtschaften. Gezielt Passagiere der Arche des Geschmacks kaufen und damit zum Überleben alter Rassen und Sorten beitragen. Wissen wollen, wo unser Essen herkommt – das ist eine ganz wichtige Tugend von uns Slow Foodies.
Und auch mit unserem Wahlrecht können wir versuchen, Entwicklungen zu beeinflussen – zum Beispiel bei der anstehenden Europawahl: Wer setzt sich für bessere Rahmenbedingungen der ökologischen Landwirtschaft ein, wer blockiert jegliches Umsteuern weg von der industrialisierten Landwirtschaft? Wer will die Gelder der gemeinsamen Agrarpolitik nach Fläche streuen, und wer will sie für Ökosystemleistungen wie den Klimaschutz und biologische Vielfalt ausgeben?
Dieser Artikel ist wurde von Gerhard Schneider-Rose, Leiter der Arche-Kommission, geschrieben und erschien zuerst im Slow Food Magazin.
Stichworte
Themen
- Agrarexporte (29)
- Pestizide (36)
- Essen ist politisch (73)
- Tierhaltung (47)
- GAP 2020 (40)