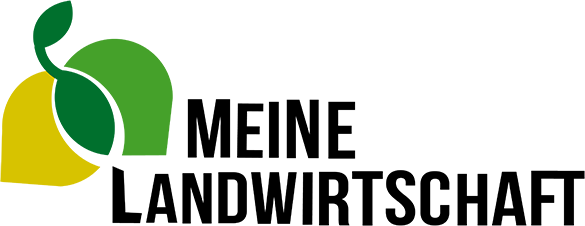Sie werden ihr Leben für Lebensmittel riskieren
Die Corona-Pandemie bedroht besonders Menschen, die bereits jetzt am Existenzminimum leben: Rund eine halbe Milliarde Menschen könnten in Armut stürzen. Die Zahl der akut Hungernden könnte sich bis Ende des Jahres verdoppeln. Und die Zahl der Menschen, die von Ernährungsunsicherheit und Unterernährung bedroht sind, könnte in Westafrika allein zwischen Juni und August von 17 Millionen auf 50 Millionen Menschen steigen. Oxfams Agrarexpertin Marita Wiggerthale erklärt, was getan werden muss, um die betroffenen Menschen zu schützen.
Das gab’s noch nie. Eine Pandemie, die überall auf der Welt grassiert. Grundrechte, die ohnegleichen beschnitten werden. Eine Wirtschaft, die allerorten erschüttert wird. Fast 2,7 Milliarden Menschen bzw. 81 Prozent der Arbeitnehmer*innen weltweit sind in irgendeiner Form von Sperren betroffen. Besonders hart trifft es die zwei Milliarden Menschen, die im informellen Sektor arbeiten.
Bilder aus Indien haben dies deutlich vor Augen geführt. Wer nur das am Tag verdiente Geld hat, um sich Lebensmittel kaufen zu können, steht mit leeren Händen da, verliert von einen auf den anderen Tag 100 Prozent seines Einkommens. Mehr als ein Viertel der Arbeit in der Landwirtschaft wird von Migrant*innen geleistet. Sie können kaum von ihrer Arbeit leben, setzen ihre Gesundheit aufs Spiel und haben keinerlei Sicherheit.
Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen von Covid19 sind enorm. Sie könnten rund eine halbe Milliarde Menschen in Armut stürzen. Das Forschungsinstitut IFPRI prognostiziert, dass die extreme Armut weltweit um 20 Prozent zunehmen könnte, wenn die Regierungen nicht gegensteuern.
Besonders betroffen werde Subsahara-Afrika sein. Nach Angaben der Weltbank gab es das letzte Mal vor 25 Jahren eine wirtschaftliche Rezession in dieser Region. Die Landwirtschaft spielt dort als Wirtschaftssektor noch eine bedeutende Rolle. Der Anteil am Bruttoinlandprodukt beträgt beispielsweise in Burkina Faso 28 Prozent, in Burundi 29 Prozent und in Äthiopien 31 Prozent. Armut hat ein ländliches Gesicht, ungefähr 80 Prozent der Armen leben im ländlichen Raum. Menschen, die in Armut leben, haben keine Lobby. Dabei sind sie diejenigen, die am meisten von Krisen betroffen sind. Auch weil sie mehrfach benachteiligt sind. Ob in punkto Bildung, Gesundheitsfürsorge, Agrarberatung und Landrechte oder Straßenanbindung, Energie-, Wasser- und Internetversorgung.
Vor Ort funktionieren Lebensmittelmärkte häufig nicht mehr
Weniger als wenig Essen heißt hungern. Millionen Menschen sind von staatlichen Lebensmittelprogrammen und städtischen Essensausgaben abhängig. Sie reichen jedoch nicht aus, um die große Nachfrage zu bedienen, so die Weltgesundheitsorganisation.
In Nigerias Hauptstadt Lagos kämpfen Menschen erbittert um Lebensmittellieferungen, weil sie kein Essen zuhause haben. Einige gehen leer aus. Lokale Märkte wurden vielfach geschlossen ohne Alternativen sicherzustellen. Lebensmittel können dort weder gekauft noch verkauft werden. Dabei sind informelle Lebensmittelmärkte zentral für die Lebensmittelversorgung und für die Einkommen von informellen Händler*innen und kleinbäuerlichen Produzent*innen. Straßenverbindungen zu wichtigen Märkten wurden gekappt. Händler*innen kommen gar nicht oder weniger ins Dorf. Bäuerliche Produzent*innen bleiben auf ihren Lebensmitteln sitzen.
Besonders dramatisch ist die Situation bei verderblichem Gemüse. Das „Center for Sustainable Agriculture“ in Indien berichtet, dass die Einnahmen der Gemüseproduzent*innen im Vergleich zu 2019 um die Hälfte eingebrochen sind. Auch im Senegal und in Mali können Bauern und Bäuerinnen ihr Gemüse nicht verkaufen. In Ostafrika ist die Lieferkette für Reis unterbrochen. In den nächsten Wochen wird es einen Mangel an Reis geben, erklärt das Reisimportunternehmen Sunrice. Lebensmittel-LKW-Fahrer sind eigentlich von den Corona bedingten Beschränkungen ausgenommen, aber viele sorgen sich um ihre Sicherheit oder haben Angst vor Bußgeldern und Verhaftungen. Dennoch ist zu lesen, dass es bislang keine „bedeutsamen Unterbrechungen“ von Lebensmittelversorgungsketten gebe.
Nahrungsmittelkrise oder Ernährungskrise?
Wenn man die FAO fragt, ob es eine Nahrungsmittelkrise gibt, lautet die Antwort „Nein, noch nicht“. IFPRI analysiert, dass alle Voraussetzungen für eine globale Ernährungskrise gegeben sind und spricht bereits von einer Ernährungskrise. Das Welternährungsprogramm warnt vor einer Hunger-Pandemie. Fest steht, die Lage ist ernst.
Bereits jetzt reichen staatliche Lebensmittellieferungen nicht aus und Millionen Menschen haben kein Geld, um sich Lebensmittel leisten zu können. Folglich ist es richtig, von einer Ernährungskrise zu sprechen. Das Welternährungsprogramm schätzt, dass die Zahl der akut Hungernden sich bis Ende 2020 verdoppeln könnte. Laut der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) könnte die Zahl der Menschen, die von Ernährungsunsicherheit und Unterernährung bedroht sind, zwischen Juni und August 2020 von 17 Millionen auf 50 Millionen Menschen steigen. Betroffen sind all jene, die ohnehin am Rande der Existenz leben, wenig Geld verdienen und keinen finanziellen Puffer haben: Marktverkäufer*innen, Tagelöhner*innen, Plantagenarbeiter*innen, Migrant*innen, kleinbäuerliche Produzent*innen und nomadische Viehzüchter*innen.
Die Menschen sind verzweifelt, wenn sie wie in Kenia durch die staatlichen Beschränkungen keinen Zugang zu Lebensmitteln haben. Sie werden ihr Leben für Lebensmittel riskieren. In Südafrika patrouilliert inzwischen das Militär, um zu verhindern, dass hungrige Menschen den „Lockdown“ durchbrechen! Wenn die Ausgangs- und Versammlungsbeschränkungen nicht wären, gäbe es vielleicht auch Proteste. Bilder aus dem Jahr 2008 kommen mir in den Sinn. Doch die Situation heute ist nicht mit der damaligen Nahrungsmittelkrise zu vergleichen.

Corona-Krise nicht mit Nahrungsmittelkrise 2008 vergleichbar
Ich habe in den letzten Wochen an mehreren Webinaren teilgenommen und die Entwicklung eng verfolgt. In der Welternährungsszene besteht Einigkeit darüber, dass die Situation heute nicht mit der Nahrungsmittelkrise 2008 vergleichbar ist. Damals explodierten die Nahrungsmittelpreise, international und in vielen Ländern des globalen Südens. Die Gründe: Ernteausfälle, Agrosprit, hohe Ölpreise und exzessive Nahrungsmittelspekulation. Exportverbote und Panikkäufe verschärften die Lage.
Heute gibt es genug Lebensmittel für alle, aber sie erreichen die Menschen nicht oder sie haben kein Geld, um sich Lebensmittel kaufen zu können. Es ist also eine „Zugangskrise“, während in 2008 die Lagerbestände sehr niedrig waren. Aktuell haben die Lagerbestände einen Anteil von 30 Prozent am weltweiten Getreideverbrauch, während im Jahr 2008 der Anteil 17 Prozent betrug und damit unterhalb der kritischen Grenze von 20 Prozent lag.
Inwieweit die Produktion durch Covid19 betroffen sein wird, lässt sich aktuell schwer beurteilen. Insgesamt werden gute Ernten vorhergesagt. Ältere, kleinbäuerliche Produzenten können im Krankheitsfall womöglich ihre Feldarbeit nicht verrichten. Im Unterschied zu 2008 werden bisher nur in wenigen Ländern Exportbeschränkungen bei Getreide verhängt. Damals war dies in 25 Ländern der Fall. Bei Weizen könnten allerdings Mitte/Ende Mai die Exportquoten in Russland ausgeschöpft sein, so dass dann ein Stopp von Exporten die Weizenpreise erhöhen könnte. Russland ist der größte Exporteur von Weizen. Auch bei Reis gab es zwischenzeitlich Exportbeschränkungen, die Vietnam eingeführt hatte.
Die Preisschwankungen haben bei Reis und Weizen entsprechend zugenommen. Sie bilden den Nährboden für die exzessive Spekulation mit Nahrungsmitteln. Von einer Preisexplosion wie im Jahr 2008 sind wir aktuell noch weit entfernt. Arme Länder, die auf Nahrungsmittelimporte angewiesen sind, müssen aber bereits jetzt mehr Haushaltsmittel für diese aufwenden, weil der Dollar aufgewertet hat. Die internationalen Handelsgeschäfte mit Getreide werden in Dollar abgewickelt.
Steigende Lebensmittelpreise und fallende Erzeugerpreise
In mehreren Ländern sind die Lebensmittelpreise bereits gestiegen. Zwischen Februar und März 2020 stiegen die Preise für einige Grundnahrungsmittel in Äthiopiens Hauptstadt um 50-100 Prozent. In Westafrika sind in den meisten Märkten höhere Getreidepreise zu verzeichnen. In Ghana sind sie um 20-33 Prozent gestiegen, zum Beispiel bei Reis und Hirse. In Burkina Faso ist in wenigen Tagen der Preis für einen 100-Kilogramm-Sack Hirse von 16.000 auf 19.000 CFA gestiegen und die Kosten für einen Liter Speiseöl haben sich verdoppelt. In Mali sind die Preise bei Hirse und Mais gestiegen.
Auch in der Ebola-Krise im Jahr 2014 war es zu einem dramatischen Preisanstieg bei Grundnahrungsmitteln gekommen. Ein Ende des Preisanstiegs ist noch nicht in Sicht. Die Weltbank prognostiziert, dass in Subsahara-Afrika die Agrarproduktion um bis zu sieben Prozent und die Nahrungsmittelimporte um bis zu 25 Prozent zurückgehen werden.
Wie kritisch die Situation bereits heute ist, wird auch an den Maßnahmen mehrerer Länder deutlich. Anfang April haben nach Angaben der FAO sechs Länder Obergrenzen für Lebensmittelpreise eingeführt, nämlich Gambia, Honduras, El Salvador, Madagaskar und Ruanda. Sechs Länder gehen gegen überteuerte Lebensmittelpreise vor. Dazu zählen Bolivien, Kolumbien, Ekuador, Madagaskar, Mosambik und Südafrika. Indonesien und Philippinen haben Lebensmittel rationiert. Äthiopien hat preisstabilisierende Maßnahmen eingeführt. Nigeria hat Getreide aus der Reserve auf den Markt gebracht. Mauretanien hat die Zölle für Lebensmittel gesenkt. Kambodscha hat Lebensmittelexporte ausgesetzt.
Auf der anderen Seite prognostiziert die FAO, dass die Erzeugerpreise fallen werden und eine Agrarkrise droht. Aus Togo wird bereits berichtet, dass kleinbäuerliche Produzenten*innen für einen 50 kg Sack Avocados 33 Prozent weniger als üblich bekommen. Die Händler verweisen auf ihre höheren Transportkosten wegen der Covid19-Restriktionen. In Ghana ist der Preis für einen 100kg Sack Cashewnüsse um 40-50 Prozent gefallen.
Was ist jetzt zu tun?
Die Corona-Krise verschärft die soziale Ungleichheit. Die lokalen Märkte, die für die Ernährungssicherung eine zentrale Rolle spielen, werden geschlossen, während Supermarktketten geöffnet bleiben. Bäuerliche Produzenten bleiben auf ihren Lebensmitteln sitzen, während Unternehmen immer noch – wenn auch eingeschränkt – ihre Lebensmittel transportieren können. Die Lebensmittelpreise steigen, während gleichzeitig die Erzeugerpreise fallen. Höhere Margen werden von einigen Händler*innen bzw. Konzernen abgeschöpft werden. Die Preisschwankungen nehmen zu und bereiten den Nährboden für die exzessive Spekulation mit Nahrungsmitteln. Die Corona-Krise offenbart die bestehenden Ungerechtigkeiten in der industriellen Landwirtschaft und im konzerndominierten Ernährungssystem. Auch diese Ernährungskrise wird von Regierungen nicht gut gemanagt. Dabei ist das Wissen über die Ungleichheit gestiegen, das jetzt für zielgerichtete Maßnahmen genutzt werden könnte. Der UN-Welternährungsausschuss (CFS) wurde 2009 reformiert, auch um sich in Krisenzeiten zukünftig besser koordinieren zu können. Die nächste Sitzung im Oktober sollte sich deshalb der Corona-Krise widmen.
Was ist jetzt zu tun? Danielle Resnick von IFPRI plädiert dafür, informelle Lebensmittelhändler*innen zu unterstützen, statt zu verfolgen. Informelle Lebensmittelmärkte sollten unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen und größeren Abständen rund um die Uhr offen sein dürfen. Das gleiche gilt für Wasserstellen für die Tiere. Staatliche Stellen sollten möglichst Lebensmittel von bäuerlichen Produzenten aufkaufen, um sie gezielt an bedürftige Menschen abgeben zu können.
Bei allen Maßnahmen müssen soziale und ökologische Wirkungen im Sinne des „built back better“ berücksichtigt werden, um die soziale Ungleichheit zu reduzieren und die Umwelt zu schützen. Dies gilt für staatliche Hilfen, Stabilisierungsprogramme und Regeln für Wirtschaftsakteure inkl. Einhaltung von Arbeitsrechten. Lasst uns nicht zur Normalität zurückkehren, denn die Normalität war das Problem, fordert die Zivilgesellschaft weltweit. Maßnahmen zur sozialen Sicherung und zum Schutz besonders gefährdeter Menschen sind dringend erforderlich. Arbeiter*innen sollten menschenwürdige Arbeitsbedingungen ermöglicht und nicht hochgefährlichen Pestiziden ausgesetzt werden. Um die lokale und regionale Lebensmittelversorgung nachhaltig zu stärken, sollten gezielt agrarökologische Ansätze von kleinbäuerlichen Produzenten gefördert werden. Denn die Krisenanfälligkeit des Ernährungssystems wird bedingt durch die Klimakrise weiter zunehmen. Die größte Bewährungsprobe steht uns allen noch bevor.
Der Text von Marita Wiggerthale wurde zuerst auf der Website von Oxfam veröffentlicht. Die Autorin ist Agrarexpertin bei der internationalen Entwicklungsorganisation.
zurück zur Übersicht